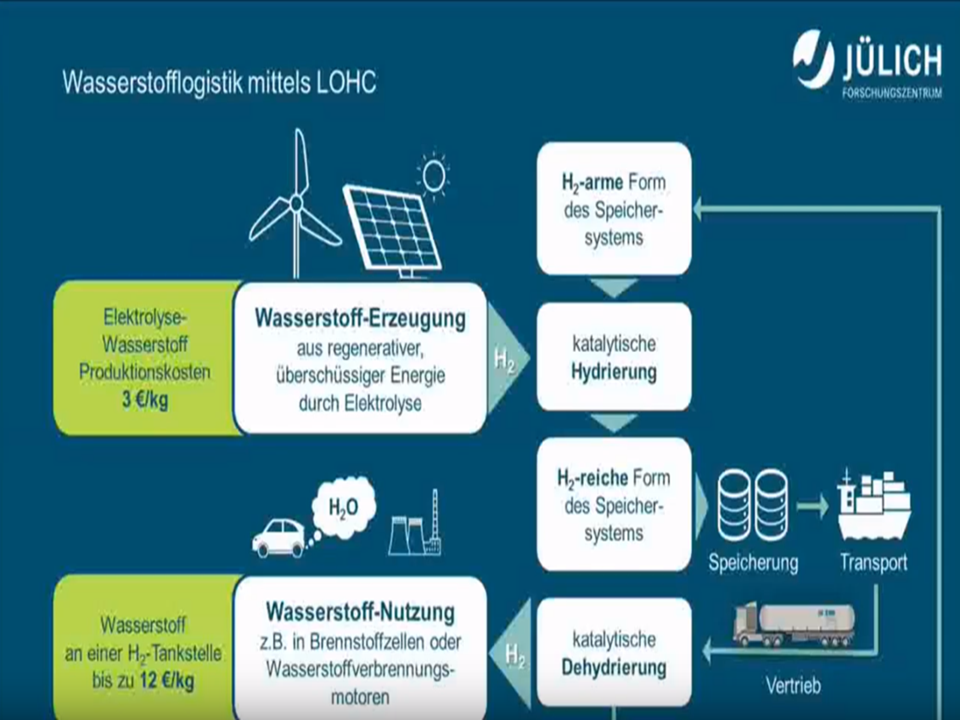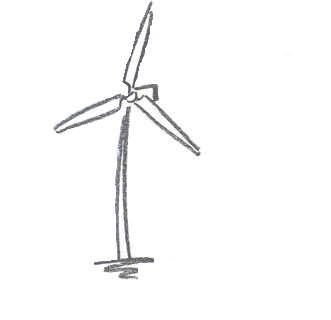19.01.2025
Wie wirken sich Windkraftanlagen auf Umwelt, Gesellschaft, Wirtschaft und Recht aus? Ein internationales Team von Forschenden liefert Antworten.
Aus über 400 Internationalen Studien ETH ZÜRICH
Windräder
Windräder haben mit einigen Akzeptanzproblemen zu kämpfen. Forschende der ETH Zürich haben ihre Auswirkungen auf Umwelt, Gesellshaft und Politik genau unter die Lupe genommen.
Getötete Vögel, Infraschall, langwierige Genehmigungsverfahren oder Recycling – Windkraftanlagen und ihre Auswirkungen auf die Umwelt sind immer wieder Thema in Politik und Gesellschaft. Forschende der ETH Zürich und anderen Forschungseinrichtungen haben sich 400 Studien zur Windkraft angeschaut und daraus selbst eine Studie erstellt. Die Arbeit identifiziert verschiedene Schüsselkategorien, die als Grundlage für künftige Forschung und politische Entscheidungen dienen sollen. Das Team arbeitet nun an Ansätzen, um die Akzeptanz von Windrädern zu erhöhen. Auch sollen interaktive Karten zu potenziellen Standorten entstehen.
Inhaltsverzeichnis
* Wie Windkraftanlagen verschiedene Systeme beeinflussen
* 1. Umwelt und Klima
* 2. Sozioökonomische Aspekte
* 3. Techno-ökonomische Systeme
* 4. Politisch-rechtliche Systeme
* Herausforderungen und innovative Ansätze
* Infraschall: Ein kontroverses Thema
* Wo der größte Handlungsbedarf besteht
* Die nächsten Schritte: Zukunftsorientierte Forschung und Planung
Wie Windkraftanlagen verschiedene Systeme beeinflussen
Die Studie untersucht umfassend, wie Windkraftanlagen verschiedene Systeme beeinflussen. „Wir wollten den aktuellen Forschungsstand zusammenfassen und herausfinden, wo noch Herausforderungen bestehen“, erläutert Russell McKenna, Experte für Energiesystemanalyse an der ETH Zürich. Zu den untersuchten Kategorien gehören:
1. Umwelt und Klima
Einfluss auf Ökosysteme und Artenvielfalt Probleme: Windräder sind bekannt dafür, Vögel und Fledermäuse durch Kollisionen zu gefährden. Besonders betroffen sind Zugvögel und Fledermausarten, die bei niedrigen Windgeschwindigkeiten aktiv sind. Offshore-Windparks können durch Unterwasserlärm Meereslebewesen wie Wale und Delfine stören.
* Lösungen:
* Gezielte Standortwahl:
Windparks sollten in Gebieten errichtet werden, die von geringem ökologischen Wert sind. Mikro-Siting (feine Standortwahl innerhalb eines Gebiets) kann helfen, Kollisionen zu minimieren.
* Technologische Ansätze:
Temporäre Abschaltungen bei hohen Tieraktivitäten, visuelle Markierungen (z. B. schwarze Rotorblätter) und Ultraschall-Abwehrsysteme für Fledermäuse.
* Beispiele:
In Norwegen wurden spezielle Sensoren entwickelt, um Bewegungen von Vögeln zu erkennen und Turbinen bei Gefahr abzuschalten.
Einfluss auf Wetter und KlimaProbleme:
Große Windparks können lokale Windmuster beeinflussen, was die Effizienz benachbarter Anlagen verringert. Zudem wurden lokal leicht erhöhte Temperaturen gemessen, vor allem nachts.
* Lösungen:
Strategische Planung, um diese Effekte zu minimieren, und internationale Abstimmungen bei Offshore-Windparks, wie z. B. in der Nordsee.
* Beispiele:
Eine Studie über die Nordsee zeigte, dass Windparks Windgeschwindigkeiten im Umkreis von bis zu 50 km um bis zu 20 % reduzieren können, wenn sie dicht beieinanderstehen.
Recycling und End-of-Life-Szenarien
* Probleme: Rotorblätter bestehen häufig aus Glasfaserverbundwerkstoffen, die schwer zu recyceln sind. Aktuell werden viele dieser Materialien deponiert.
* Lösungen: Forschung an innovativen Materialien, die leichter recycelbar sind, und der Ausbau chemischer Recyclingverfahren wie Pyrolyse.
* Beispiele: In Deutschland wurde ein Verbot der Deponierung von Rotorblättern eingeführt, was die Entwicklung neuer Recyclingverfahren beschleunigt hat.
Seltene Erden
* Probleme: Permanentmagnete in modernen Turbinen enthalten Materialien wie Neodym und Dysprosium, die größtenteils in China abgebaut werden, was geopolitische Risiken birgt.
* Lösungen: Entwicklung von Turbinen ohne Permanentmagnete, Recyclingprogramme und Diversifizierung der Lieferketten.
* Beispiele: Siemens Gamesa hat eine Turbine entwickelt, die auf Ferritmagnete statt Seltener Erden setzt.
2. Sozioökonomische Aspekte
Landnutzungskonflikte
* Probleme: Windkraftprojekte können indigene Gemeinden oder traditionelle Landnutzer verdrängen, besonders in ländlichen Gebieten.
* Lösungen: Anerkennung traditioneller Landrechte, transparente Planungsverfahren und faire Entschädigungen.
* Beispiele: In Mexiko führte der Bau eines Windparks im Isthmus von Tehuantepec zu Konflikten mit indigenen Gemeinschaften, die sich gegen mangelnde Mitbestimmung wehrten.
Monetäre Auswirkungen
* Probleme: Windkraftanlagen können Immobilienwerte senken und Tourismus beeinflussen.
* Lösungen: Beteiligungsmodelle, bei denen Anwohner finanziell von Windparks profitieren, z. B. durch günstigeren Strom oder direkte Zahlungen.
* Beispiele: In Dänemark gibt es Programme, bei denen Anwohner Aktien von Windparks kaufen können, um von den Erträgen zu profitieren.
Landschaftsbild
* Probleme: Windkraftanlagen werden oft als Störung des Landschaftsbilds wahrgenommen, insbesondere in naturnahen Gebieten.
* Lösungen: Bau in bereits genutzten Gebieten, Beteiligung der Gemeinden an der Standortwahl.
* Beispiele: In Schottland werden Windparks in ehemalig industriellen Regionen bevorzugt gebaut, um die Akzeptanz zu erhöhen.
Gesundheitliche Auswirkungen
* Probleme: Geräusche und Schattenwurf können Anwohner stören und Stress auslösen.
* Lösungen: Einhaltung von Abstandsregeln, Betriebseinschränkungen bei hohem Schattenwurf.
* Beispiele: In Deutschland wird eine maximale Beschattungsdauer von 30 Minuten pro Tag für Anwohner eingehalten.
3. Techno-ökonomische Systeme
Integration in Energiesysteme
* Probleme: Windenergie ist wetterabhängig und erfordert flexible Stromnetze und Speicher.
* Lösungen: Ausbau von Stromspeichern, intelligente Steuerungssysteme, wie sie in Smart Grids verwendet werden.
* Beispiele: In Deutschland wurde der Netzausbau durch den Bau von HGÜ-Leitungen (Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungsleitungen) vorangetrieben.
Markt- und Preisauswirkungen
* Probleme: Windenergie kann durch ihren niedrigen Strompreis bestehende Kraftwerke unrentabel machen und Preisschwankungen verstärken.
* Lösungen: Einführung von Kapazitätsmärkten und flexiblen Preisregelungen.
* Beispiele: Großbritannien hat ein Enhanced Frequency Response-System eingeführt, das Batteriespeicher zur Stabilisierung des Netzes nutzt.
4. Politisch-rechtliche Systeme
Geopolitische Risiken
* Probleme: Abhängigkeit von seltenen Rohstoffen und Technologien aus bestimmten Ländern.
* Lösungen: Ausbau lokaler Produktion und Forschung an alternativen Materialien.
* Beispiele: Die EU hat die „Raw Materials Initiative“ gestartet, um die Abhängigkeit von China zu reduzieren.
Cybersicherheit
* Probleme: Windparks sind anfällig für Cyberangriffe, die Betrieb und Überwachung gefährden können.
* Lösungen: Einsatz sicherer Kontrollsysteme und regelmäßige Sicherheitsprüfungen.
* Beispiele: In Deutschland kam es 2022 zu Angriffen auf die IT-Infrastruktur eines Windkraftanlagenherstellers.
Planungs- und Genehmigungsprozesse
* Probleme: Lange Genehmigungszeiten verzögern den Ausbau.
* Lösungen: Einführung von Vorranggebieten für Windkraft und schnellere Verfahren.
* Beispiele: Die EU-Richtlinie 2023 erlaubt beschleunigte Genehmigungen in festgelegten „Go-To“-Zonen.
Herausforderungen und innovative Ansätze
Ein zentrales Problem ist laut Studie das Recycling von Rotorblättern. McKenna hebt hervor: „Duroplastische Kunststoffe wie Epoxidharz können nicht schmelzen, sodass eine Rückgewinnung der Glasfasern nahezu unmöglich ist.“ Viele dieser Blätter werden derzeit zerkleinert und auf Deponien oder in inoffiziellen Zwischenlagern entsorgt. Technologien wie die Pyrolyse, eine thermochemische Behandlung ohne Sauerstoff, können Glasfasern und andere Materialien zurückgewinnen, allerdings ist diese Methode wirtschaftlich kaum attraktiv.
Fortschritte in der Materialentwicklung, wie etwa die Verwendung neuer Harze, die sich am Ende der Lebensdauer auflösen lassen, könnten das Problem in Zukunft lösen. Diese Entwicklungen zeigen, dass eine Kombination aus technologischen Innovationen und Kreislaufwirtschaftsansätzen erforderlich ist, um das Material am Ende der Lebensdauer wieder nutzbar zu machen.
McKenna betont, dass die Belastungen durch solche Herausforderungen immer im Kontext der positiven Effekte von Windenergie betrachtet werden sollten, insbesondere der Reduktion fossiler Energieträger.
Infraschall: Ein kontroverses Thema
Ein weiteres oft diskutiertes Thema ist der sogenannte Infraschall – niederfrequente Geräusche, die von Windkraftanlagen ausgehen. In der öffentlichen Wahrnehmung wird Infraschall häufig als Ursache für gesundheitliche Beschwerden oder als Störquelle dargestellt. McKenna stellt jedoch klar: „Entgegen der weit verbreiteten Annahme gibt es kaum wissenschaftliche Beweise für schädliche Auswirkungen von niederfrequentem Lärm heutiger Windkraftanlagen.“
Tatsächlich basiert die öffentliche Debatte oft auf einer einzigen Studie, die vor Jahrzehnten durchgeführt wurde und frühe Prototypen untersuchte. Aktuelle Forschung zeigt, dass moderne Anlagen keinen nachweisbaren Zusammenhang zwischen Infraschall und gesundheitlichen Problemen herstellen können. Dennoch betont McKenna die Notwendigkeit weiterer Forschung, um Ängste in der Bevölkerung abzubauen und fundierte Entscheidungen zu ermöglichen.
Wo der größte Handlungsbedarf besteht
Ein zentraler Punkt, den McKenna hervorhebt, ist die Akzeptanz der Bevölkerung. „Die Menschen wollen die Energie nutzen, aber das „Problem“ der Auswirkungen sollte woanders liegen“, erklärt er. Besonders wichtig sei es, die Vorteile der Windenergie für lokale Gemeinschaften sichtbarer zu machen.Eine mögliche Lösung sei die direkte Einbindung der Bevölkerung, beispielsweise durch finanzielle Beteiligung an Projekten oder durch Schaffung lokaler Arbeitsplätze. Ein weiterer Handlungsbedarf ergibt sich bei der Integration von Windenergie in bestehende Energiesysteme, wo Speichertechnologien und Netzverstärkungen eine Schlüsselrolle spielen.
Die nächsten Schritte: Zukunftsorientierte Forschung und Planung
Im Rahmen des EU-finanzierten Projekts „Wind In My Backyard“ (WIMBY) arbeitet McKennas Team an innovativen Ansätzen, um viele der identifizierten Herausforderungen zu bewältigen. Ein wichtiger Bestandteil ist die Entwicklung einer europaweiten Karte der Landschaftsqualität. Mithilfe eines maschinellen Lernmodells und Crowdsourcing-Daten wird die sogenannte „Scenicness“ – die visuelle Qualität einer Landschaft – analysiert. Dieses Werkzeug soll Planern helfen, Standorte zu identifizieren, die sowohl für Windparks geeignet als auch von der öffentlichen Akzeptanz unterstützt werden.
Ein weiteres Ziel des Projekts ist die Erstellung interaktiver Karten, die eine Vielzahl von Informationen über potenzielle Standorte von Windparks bereitstellen. Diese Karten sollen es Nutzern ermöglichen, die Machbarkeit, die Auswirkungen und die Vorteile einzelner Projekte detailliert zu analysieren.
Abschließend betont McKenna die Notwendigkeit eines ganzheitlichen Ansatzes: „Es ist entscheidend, das Gesamtbild zu betrachten und nicht nur einzelne Vor- oder Nachteile von Energietechnologien zu isolieren.“ Die umfangreiche Tabelle der Studie, die die Ergebnisse von über 400 Arbeiten zusammenfasst, liefert eine fundierte Grundlage für Forschung und Politik.
Hier geht es zur Originalpublikatio